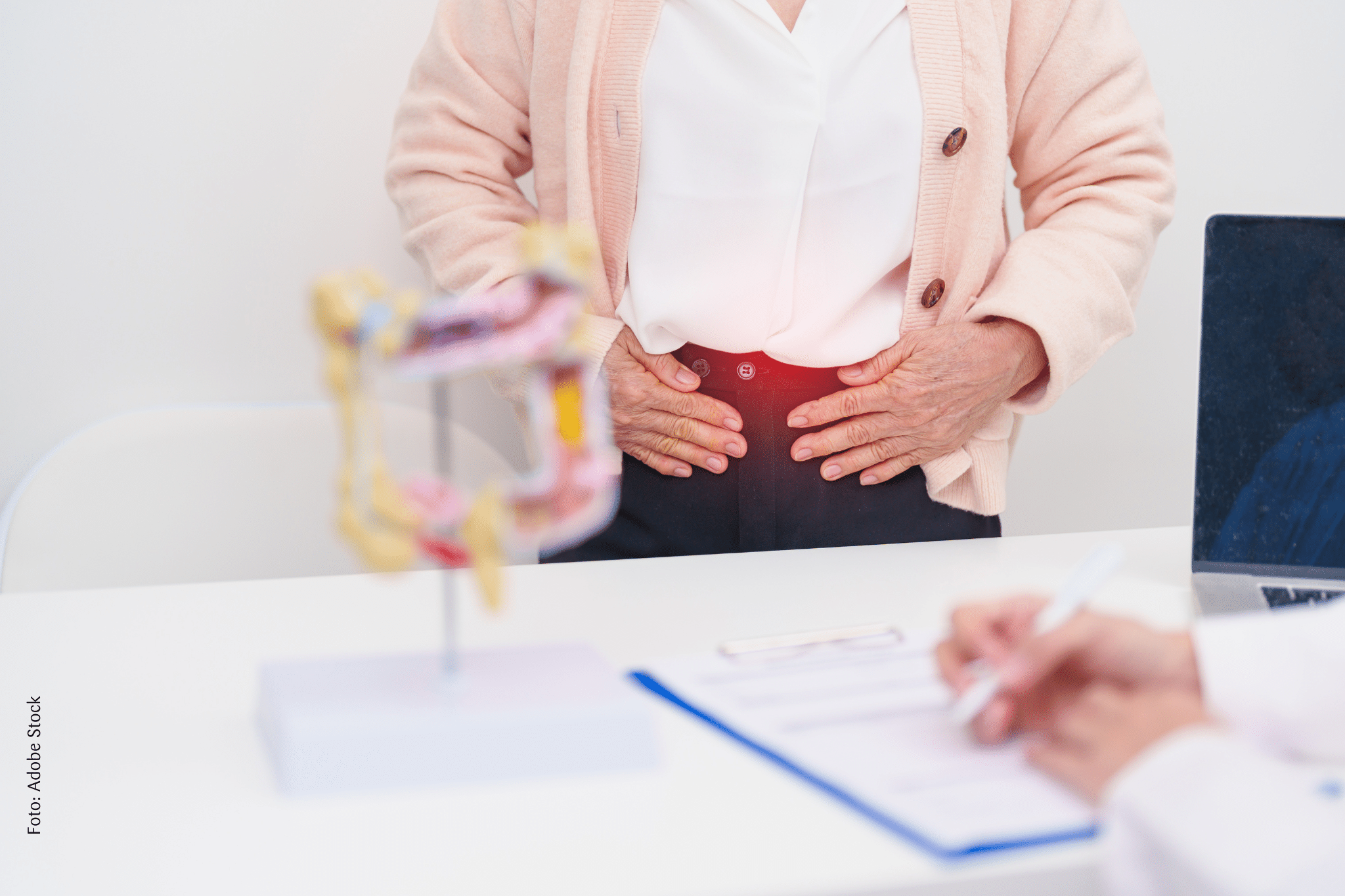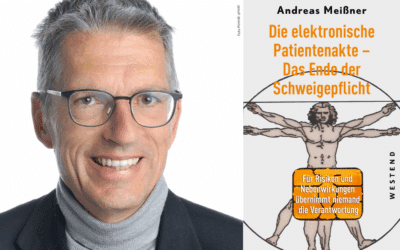Knapp eine halbe Million Menschen in Deutschland leben mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED). Doch während die Zahl der verfügbaren Medikamente und Therapien steigt, geht die Zahl der Fachärztinnen und Fachärzte zurück, die sich der Betroffenen annehmen. Die beiden Gastroenterologen Priv.-Doz. Dr. Thomas Klag und Dr. Florian Grabs erzählen, wie das kürzlich gestartete und von MEDI unterstützte Projekt „specialiCED“ helfen soll, die Versorgungslücke mit einer umfassenden, praxisnahen Datenbasis schließen und so den Weg für bessere Therapieentscheidungen in der Praxis ebnen soll.
Bei CED handelt es sich um ein komplexes Krankheitsbild, das für die Betroffenen mit großen persönlichen Belastungen einhergeht. In den vergangenen Jahren sind zwar etliche neue hochwirksame Medikamente zur Therapie von Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa auf den Markt gekommen, doch sämtliche verfügbare Substanzen führen jeweils nur in maximal 30 bis 40 Prozent der Fälle zu einer langfristigen Remission der Erkrankung. Angesichts der hohen Kosten für die neuen Biologika und JAK-Inhibitoren ist es auch aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, die verfügbaren Medikamente möglichst zielgerichtet einzusetzen. Einer der Gründe für die niedrigen Ansprechraten beschreibt Priv.-Doz. Dr. Thomas Klag aus Stuttgart so: „In Zulassungsstudien beispielsweise werden die Patienten nicht nach Untergruppen mit bestimmten Eigenschaften stratifiziert, sondern stellen ein gut definiertes durchschnittliches Patientenkollektiv dar. Deshalb bilden sie längst nicht alle Aspekte der Versorgungsrealität ab. Denn es gibt bei CED sehr viele Subgruppen, die unterschiedlich gut auf die verschiedenen Substanzen ansprechen, die wir bisher nur ungenau kennen – gerade im langfristigen Verlauf einer chronischen Erkrankung.“ Sein in Tauberbischofsheim niedergelassener Kollege Dr. Florian Grabs ergänzt: „Wir haben es mit extrem unterschiedlichen Krankheitsverläufen zu tun, die sich in einer klassische Studienstruktur gar nicht darstellen lassen.“
‚Versuch und Irrtum‘ durch personalisierte Medizin ersetzen
Weil es an verbriefter Evidenz für die vielen Subgruppen fehlt, verlassen sich niedergelassene Gastroenterologinnen und Gastroenterologen bei ihren therapeutischen Entscheidungen deshalb in der Regel auf ihre persönlichen Erfahrungen. Grabs erklärt dazu: „Der Pathomechanismus bei CED ist sehr individuell, weil es so viele Angriffspunkte gibt, an denen bei der Immunreaktion etwas schieflaufen kann. Aktuell arbeiten wir eher nach dem Prinzip ‚Versuch und Irrtum’ statt wirklich personalisierte Medizin zu betreiben.“ Doch es ist nicht nur die mangelnde Evidenzgrundlage, die bei ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen für Frust sorgt. „CED-Therapie ist ein Zuschussgeschäft“, sagt Grabs mit Blick auf Arzneimittelbudgets und Regressrisiko.
Mit ihrer IT-basierten Plattform specialiCED wollen Klag und Grabs gemeinsam mit der MEDIVERBUND AG die CED-Behandlung verbessern. Ziel ist es, Behandlungsdaten aller beteiligten Praxen systematisch zu erfassen und auszuwerten – und so auf lange Sicht eine Datenbasis für differenzierte therapeutische Entscheidungen zu schaffen, die über bisherige Studiendaten deutlich hinausgeht. Grabs erklärt: „An den großen Zulassungsstudien haben jeweils etwa 400 bis 500 Patientinnen und Patienten teilgenommen. Wenn wir allein in Baden-Württemberg pro Praxis 100 Fälle beisteuern, kommen schnell sehr große Datenmengen zusammen.“ Und Klag ergänzt: „Mit unserer Datenbank können wir dann aus dem Erfahrungsschatz aller Beteiligten schöpfen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, im Einzelfall die jeweils am besten geeignete Therapieoption auszuwählen und insgesamt Muster für sinnvolle Therapiesequenzen zu erkennen.“ Auf lange Sicht soll künstliche Intelligenz (KI) zur Unterstützung der ärztlichen Entscheidungsfindung in das Projekt integriert werden – vergleichbar mit KI-Tools, wie sie bereits in der Radiologie international erfolgreich im Einsatz sind. Für die Gastroenterologie hingegen gibt es dergleichen auch in anderen Ländern noch nicht, „da leisten wir echte Pionierarbeit“, meint Klag, „unser Ansatz, diese Daten KI-basiert zu analysieren, ist Neuland in der Versorgung.“ Auf diese Weise ließe sich auch das Regressrisiko minimieren, weil sich die Verordnung an erprobten Mustern in einem stetig lernenden System orientiert – und nicht allein an Studien mit begrenzter Aussagekraft zu klinischen Prädiktoren.
Über Durststrecken bei Partnerschaft mit MEDI gelandet
Nach fünf Jahren Entwicklungs- und Planungsarbeit hat am 23. Juni 2025 nun die Erhebungsphase von specialiCED begonnen. Aktuell beteiligen sich 20 Ärztinnen und Ärzte sowie 14 Medizinische Fachangestellte aus 13 Praxen in Baden-Württemberg. Klag erläutert: „Es geht darum, echte Patientenverläufe zu dokumentieren, gut auswertbar zu machen und die Analyseergebnisse dann für automatisierte Therapieempfehlungen zu nutzen.“ Die beiden Gastroenterologen erinnern sich gut an 2020, als sie in ersten Gesprächen mit Firmen zusammensaßen und überlegten, wie man die Versorgung besser strukturieren könnte. „Es ist nicht leicht, Geld für ein solches Projekt aufzutreiben und geeignete Partner zu finden. Denn immerhin ist die Programmierung einer solchen Plattform teuer und aufwändig“, sagt Grabs.
Er erzählt weiter: „Wir sind über einige Durststrecken dann bei einer Partnerschaft mit MEDI gelandet. Es ist super, den Verband mit seiner IT-Infrastruktur und der juristischen Unterstützung im Hintergrund zu haben.“ Die Ärzte wiederum lieferten den medizinischen Input. Es war eine zeitintensive Freizeitbeschäftigung, wie Klag betont: „Es gab Wochen, in denen wir jeden Abend zwei bis drei Stunden lang an unserem Projekt gearbeitet haben.“
Praxen hoffen auf Arbeitserleichterung und bessere Therapieergebnisse
Bei einer Kick-Off-Veranstaltung Ende 2023 konnten sich auch andere gastroenterologische Praxen über das Projekt informieren. Die Resonanz war überwältigend: Die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen erkannten rasch das Potenzial von specialiCED für ihr eigenes Qualitätsmanagement, verknüpften mit der Plattform aber auch hohe Erwartungen. So versprachen sie sich davon nicht nur eine enorme Arbeitserleichterung durch nahezu automatisierte Dokumentation, sondern beispielsweise auch eine Verknüpfung mit der Abrechnung und eine integrierte Patienten-App. „Wir wünschen uns alle die eierlegende Wollmilchsau – aber manches ist natürlich noch Zukunftsmusik“, meint Grabs. Von den universitären Kolleginnen und Kollegen hingegen schlug den Initiatoren große Skepsis entgegen. Nicht unbedingt verwunderlich, findet sein Kollege Klag: „Natürlich ist das ganze Programm auch ein gewisser ‚Angriff‘ auf die etablierte Studienlandschaft, weil wir damit so große Mengen an Real-Life-Daten erheben, die bis dato noch nicht zur Verfügung stehen.“
In etlichen Diskussionsrunden und zwei weiteren Informationsveranstaltungen wurde Feedback gesammelt und über die Bedürfnisse der Praxen diskutiert. Jetzt ist das Projekt startklar: „Wir befinden uns nun in der Proof-of-Concept-Phase und haben ein Jahr Zeit, um zu schauen, ob das Modell funktioniert“, erklärt Grabs. Der aktuelle Prototyp der Plattform, mit dem specialiCED in die Erhebungsphase gestartet ist, hat zwar noch keine Schnittstelle zu den Praxisverwaltungssystemen (PVS) – diese soll im nächsten Schritt nach der abschließenden Evaluation und dem flächendeckende Rollout realisiert werden. Die beteiligten Praxen müssen ihre Daten daher zunächst manuell eingeben. Für diesen Mehraufwand erhalten sie eine Vergütung.
Nächste Etappenziele: KI-Integration und ein Strukturvertrag
Diese Arbeit soll sich für die Fachgruppe auch finanziell auszahlen: „Im Idealfall können wir nach der Evaluation belegen, dass sich mithilfe von specialiCED die CED-Therapie kosteneffizient verbessern lässt. Dann wollen wir mit Krankenkassen Verhandlungen für einen entsprechenden Strukturvertrag aufnehmen, damit wir eine bessere Vergütung für unsere derzeit unterfinanzierte Arbeit erhalten“, erklärt Klag. Doch selbst wenn nach zwölf Monaten noch keine Verträge mit Kostenträgern geschlossen wurden, können teilnehmende Praxen die Plattform weiter nutzen.
Auch jetzt können noch weitere gastroenterologische Praxen in die Erhebungsphase von specialiCED einsteigen. Interessierte melden sich bitte bei Celina Schick unter celina.schick@medi-verbund.de
Antje Thiel