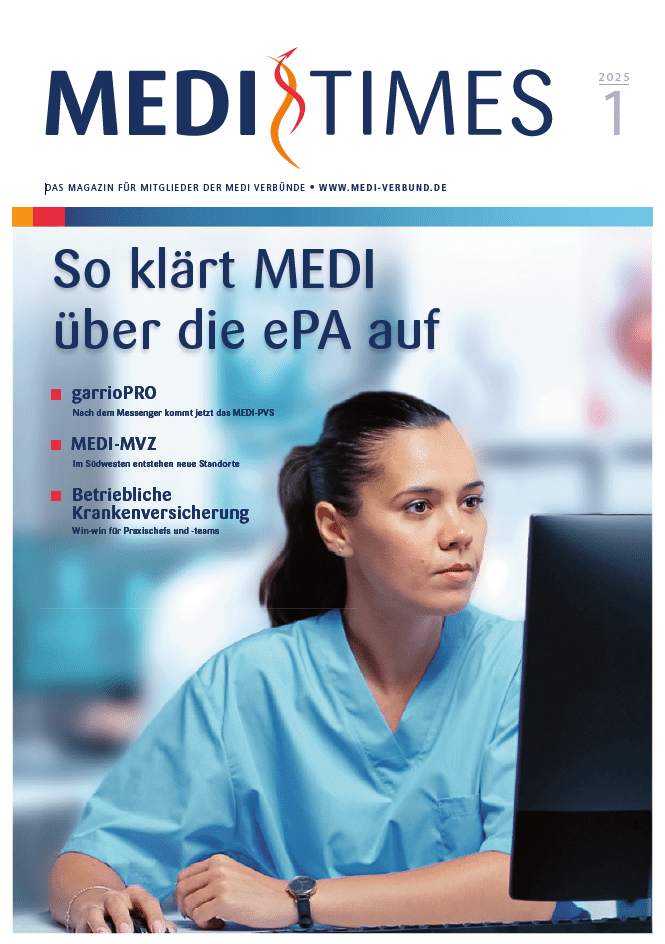Dürfen Vertragsärzte streiken oder sich an streikähnlichen Kampfmaßnahmen beteiligen? Mit dieser Frage und der damit verbundenen Verfassungsbeschwerde des MEDI Verbunds beschäftigt sich immer noch das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 887/17). Rechtsanwalt Dr. jur. Joachim B. Steck, Fachanwalt für Medizinrecht, vertritt MEDI in diesem Fall und erklärt hier den grundsätzlichen Sachverhalt dazu.Wenn es nach dem Bundesozialgericht geht, unterliegen Vertragsärzte einem absoluten Streikverbot. Streiks von verschiedenen Berufsgruppen sind zwar keine Seltenheit. Sie gehören vielmehr seit vielen Jahren traditionell zu den anerkannten Protestmaßnahmen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Das gilt allerdings nicht für Vertragsärzte, wenn es nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts geht.Das Gericht hat in seiner Entscheidung vom 30.11.2016 (B 6 KA 38/15 R) ausgeführt, dass Praxisschließungen zum Zweck der Durchführung streikähnlicher ärztlicher Kampfmaßnahmen eine Verletzung vertragsärztlicher Pflichten darstellen. Zwar ergebe sich aus dem Gesetz kein ausdrückliches Verbot von kollektiven Kampfmaßnahmen wie beispielsweise der eines mehrstündigen „Warnstreiks“.Das Streikverbot und das Verbot streikähnlicher Kampfmaßnahmen ergeben sich aber aus der historisch gewachsenen Konzeption des Vertragsarztrechts. In diesem System sei schlichtweg kein Platz für solche Maßnahmen, auch nicht als ultima ratio. Aus diesem Grund gelte das systemimmanente Streikverbot nicht nur für Vertragsärzte, sondern für alle Ärzte, die innerhalb des GKV-Systems an der Versorgung der Versicherten beteiligt sind, also beispielsweise auch für angestellte Ärzte in Einzelpraxen, Berufsausübungsgemeinschaften oder einem Medizinischen Versorgungszentrum.Offene FragenDabei hat der Kassenarztsenat offengelassen, ob sich Vertragsärzte auf den Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG und dem aus der Koalitionsfreiheit abgeleiteten Streikrecht berufen können. Traditionell beschränke sich der Schutzbereich dieses Grundrechtes auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber; da Vertragsärzte keine Arbeitnehmer sind, sei ihnen eine Berufung auf dieses Grundrecht dann versagt, wenn der Schutzbereich ausschließlich Arbeitnehmer und Arbeitgeber erfasse.Entsprechendes gelte für Art. 11 Abs. 1 EMRK, wenn man die Koalitionsfreiheit auf Arbeitnehmerseite nur den Gewerkschaften als Zusammenschluss abhängig Beschäftigter zugestehe. Ob dies der Fall sei, hat der Senat ausdrücklich offengelassen und darauf hingewiesen, dass diese Frage in Rechtsprechung und Schrifttum unterschiedlich beantwortet werde. Im Ergebnis führe jedenfalls das aus dem Vertragsarztrecht abgeleitete systemimmanente absolute Streikverbot zur generellen Versagung solcher Kampfmaßnahmen.Auch Beamte sahen sich streikberechtigtIn jüngster Zeit kam sogar die jahrzehntelang einhellig vertretene Rechtsauffassung zum absoluten Streikverbot für Beamte bei den Gerichten ins Wanken. So hatte u.a. das Bundesverwaltungsgericht das aus Art. 33 V GG abgeleitete Streikverbot für Beamte gelockert. Art. 11 EMRK gewährleiste in seiner bindenden Auslegung durch den EGMR allen Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die nicht in den Streitkräften, der Polizei oder der unmittelbaren Hoheitsverwaltung tätig seien, ein Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen. Das für Beamte traditionell aus Art. 33 V GG abgeleitete Streikverbot sei deshalb mit Art 11 EMRK nicht vereinbar. Der Gesetzgeber sei dazu aufgerufen, diese rechtliche Kollisionslage aufzulösen und im Wege der praktischen Konkordanz einen Ausgleich zu finden.Das Bundesverfassungsgericht ist dieser Auffassung nicht gefolgt (BVerfG, Urt. v. 12.06.2018, 2 BvR 1738/12 ua). Vielmehr stehe das Streikverbot für Beamte als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums auch mit den Vorgaben des Art. 11 EMRK in Einklang. Es bleibt abzuwarten, ob sich nunmehr internationale Gerichte dieser Frage weiter annehmen.Dr. jur. Joachim B. Steck